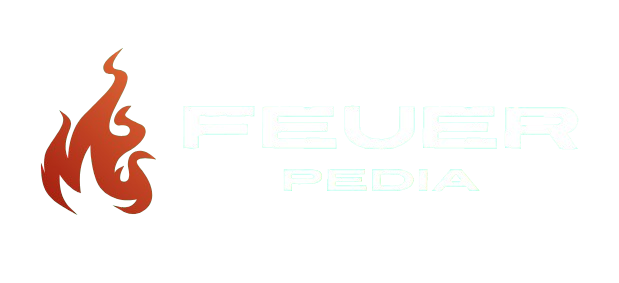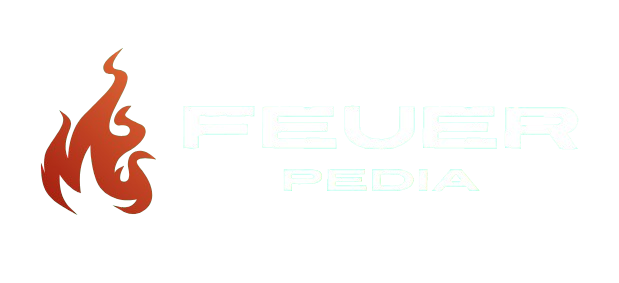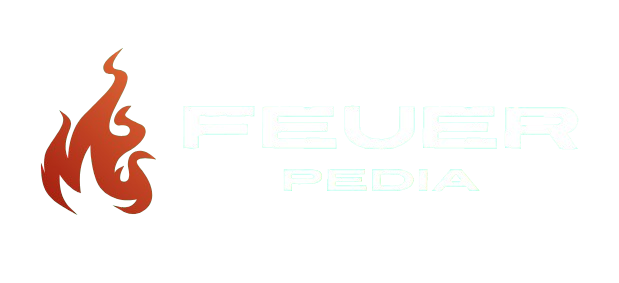
Vorgehen der Feuerwehr bei Bränden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
Lageerkundung
- Erkundung der Einsatzstelle mit der sogenannten AUTO-Regel als Gedächtnisstütze.
- Prüfung, ob das Fahrzeug noch fahrbereit ist.
- Beschädigte Hochvolt-Komponenten (HV-Komponenten) dürfen nicht berührt werden, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten.
Brandbekämpfung
- Fokus auf die Energiespeicher, insbesondere die Batterie.
- Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände nach den Vorgaben der VDE.
- Brandbekämpfung mit ausreichend Wasser, das auch in das Batteriegehäuse eindringen muss, um eine wirksame Kühlung zu gewährleisten.
Löschmittel
- Bei Bedarf Einsatz von Netzmitteln (Löschzusätzen), um die Löscheffizienz zu steigern.
Sicherung und Übergabe
- Nach erfolgreichem Löschen Übergabe des Fahrzeugs an ein qualifiziertes Bergeunternehmen.
- Information des Bergungsunternehmens über das Risiko einer möglichen Rückzündung, bereits durchgeführte Maßnahmen und Anforderungen an den Lagerplatz.
Gefahrstoffmanagement
- Giftige Stoffe können bei der Brandbekämpfung freigesetzt werden.
- Konsequente Einsatzstellenhygiene und anschließende Dekontamination von Schutzkleidung und Ausrüstung sind erforderlich.
Abtransport
- Transport des Fahrzeugs ggf. nach ADR-Vorschriften, besonders bei größeren Mengen beschädigter Batterien.
Herausforderungen für die Feuerwehr
- Batterielöschung gestaltet sich oft schwieriger als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, da die Batteriegehäuse schwer zugänglich sind.
- Rückzündungsgefahr: Erneute Brandausbrüche auch nach dem Löschvorgang möglich.
- Gefahrstoffe: Freigesetzte giftige Gase und Dämpfe stellen zusätzliche Gefahren dar.
- Spezielle Ausrüstung für Brandbekämpfung und Bergung notwendig.
- Längere Einsatzdauer wegen kontinuierlicher Kühlung und Überwachung der Batterie.